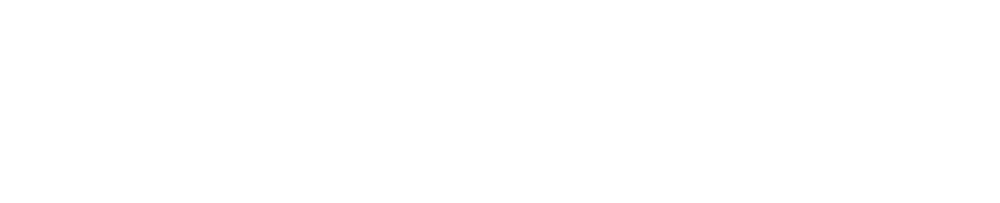Bis 2050 will die Schweiz unter dem Strich keine Treibhausgasemissionen mehr verursachen. In den kommenden Jahren wird sich auch der Gebäudepark schrittweise von fossilen Energien verabschieden und sie durch erneuerbare ersetzen. Der Ertrag socher Anlagen hängt allerdings von der Witterung sowie der Tages- und Jahreszeit ab. Um Angebot und Nachfrage in Einklang zu bringen, sind Speicherlösungen nötig, denn sie bieten die erforderliche Flexibilität.
Derzeit sind Speichersysteme auf Arealen oder grösseren Überbauungen noch nicht sehr verbreitet, was zum Teil mit den noch hohen Investitionskosten zu tun hat. Auch wenn die Wirtschaftlichkeit von Speichersystemen noch nicht in jedem Fall gegeben ist – schon heute profitieren Eigentümerschaften, die ihre integrierten Energielösungen auf Basis erneuerbarer Quellen und mit Speichern betreiben. Denn sie verbessern die CO₂-Bilanz der Immobilien und reduzieren die Abhängigkeit von fossilen Energieimporten aus dem Ausland mit ihren teils stark schwankenden Preisen.
Der in dezentralen Anlagen produzierte Solarstrom übernimmt im Energiesystem eine immer wichtigere Rolle. Im Sommer und bei starker Sonneneinstrahlung übersteigt die Produktion jedoch oft den Bedarf vor Ort. Damit die Überschüsse nicht ungenutzt bleiben oder ins Netz eingespeist werden müssen, braucht es Möglichkeiten, sie kurz- und langfristig zu speichern, sodass sie in Zeiten niedrigerer Produktion zur Verfügung stehen. Eine davon sind stationäre Batteriespeicher. Laut den Prognosen der Energieperspektiven 2050+ des Bundes dürften bis 2050 etwa 70 Prozent der Photovoltaikanlagen mit solchen Stromspeichern kombiniert sein.
Als Standard-Stromspeicher dient heute die Lithium-Ionen-Batterie, die auch in Smartphones und Elektroautos zum Einsatz kommt. Eine umweltfreundlichere und günstigere Alternative sind Natrium-Ionen-Batterien, doch diese haben sich nicht zuletzt wegen des grösseren Platzbedarfs noch nicht durchgesetzt. Auch Salzbatterien sind eine interessante Variante, allerdings lassen sie sich weniger schnell be- und entladen und haben einen tieferen Wirkungsgrad.

Erneuerbare Heizsysteme mit Wärmepumpen lassen sich durch Wärmespeicher ergänzen, die in Arealen und Überbauungen oder in grossen thermischen Netzen eingesetzt werden können. Sie tragen auch deshalb zur Dekarbonisierung bei, weil die Spitzenlastabdeckung nicht oder nur in geringem Umfang durch fossile Energieträger sichergestellt werden muss. Einige Speichertypen lassen sich zudem im Sommer als Wärmesenke nutzen, um Gebäude mit wenig Energieaufwand zu kühlen.
Erdsonden-Wärmespeicher
Der hierzulande wohl am weitesten verbreitete Speichertyp ist der Erdsonden-Wärmespeicher. Das Erdreich dient nicht nur als primäre Wärmequelle, sondern wird auch thermisch aufgeladen. Bei diesem als «Regeneration» bezeichneten Prozess lässt man im Sommer warmes Wasser durch die Sonden zirkulieren, um das im Winter ausgekühlte Erdreich wieder zu erwärmen.
Behälter-Wärmespeicher
Behälter-Wärmespeicher bestehen aus vorgefertigten oder vor Ort erstellten Tanks aus Beton oder Stahl, die einen Wärmeträger bzw. ein Speichermedium enthalten. Weil die Energiedichte mit steigender Speichertemperatur zunimmt, sollten Behälter-Wärmespeicher auf möglichst hohe Temperaturen geladen werden. Ohne zusätzlichen Druck liegt die maximale Speichertemperatur für wasserbefüllte Behälter-Wärmespeicher bei 100 °C.
Eisspeicher
Eine noch recht neue Variante ist der Eisspeicher. Als Speichermedium dient Wasser, das in einem meist betonierten Tank lagert. Wird im Winter thermische Energie für die Versorgung einer Wärmepumpe benötigt, entzieht man dem Speicher Wärme. Dabei gefriert das Wasser nach und nach, was viel Wärme, die sogenannte Kristallisationsenergie, freisetzt. Diese kann via Wärmepumpe für die Beheizung und die Warmwasserversorgung genutzt werden.

Eine weitere Möglichkeit zur saisonalen Speicherung von Stromüberschüssen ist deren Umwandlung in ein Gas wie Wasserstoff oder Methan («Power-to-Gas»). Bei Bedarf kann das Gas entweder zur Produktion von Wärme und Strom oder direkt als Treibstoff für Fahrzeuge verwendet werden. Der einfachste und effizienteste Weg, aus erneuerbarem Strom ein synthetisches Gas zu erzeugen, ist die Elektrolyse von Wasser. Dabei wird das Wasser unter Einsatz von Strom in Wasserstoff und Sauerstoff aufgespaltet.
Wasserstoff kann man in einem weiteren Schritt in Methan umwandeln. Ein Weg führt über die chemische Reaktion von Wasserstoff und CO₂ unter hohem Druck und hoher Temperatur. Der andere Weg besteht darin, dass die Umwandlung durch Mikroorganismen in einem Fermenter erfolgt – bei deutlich tieferen Temperaturen und Normaldruck. Für beide Wege bestehen bereits technische Lösungen; sie werden in der Praxis auch schon angewendet.
Welche Speicher auf Arealen oder grösseren Überbauungen eingesetzt werden, erfahren Sie in unserem neuen Whitepaper «Energiespeicher für Immobilien: Erneuerbare Energien effizient nutzen». Darin werden auch konkrete Beispiele vorgestellt.